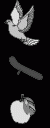Joachim Bauer und die Evolutionstheorie
20. Januar 2009 - 09:54 UhrIch hätte nicht gedacht, dass „Das kooperative Gen“ von Joachim Bauer /1/ einen solchen Wirbel unter den Bloggern auslösen würde. Leider konzentriert sich die Debatte mehr um seinen Untertitel „Abschied vom Darwinismus“ als um das Wesen der Sache. Ich weiß ja nicht, was sich Bauer bei dieser wenig glücklichen Formulierung gedacht hat, Aufmerksamkeit hat er damit jedenfalls erreicht, den Anstoß zu einer ernsthaften Auseinandersetzung hat sie jedoch noch nicht gegeben. Nicht dass die „Autoren“ mancher Verunglimpfung nicht gelegentlich amüsant sein könnten, das intellektuelle Niveau der Debatte um die Evolutionstheorie haben sie nicht befördert.
Muss eigentlich jede Verteidigung des Darwinismus und der Evolutionstheorie darin bestehen, seine Kritiker zu diffamieren? Kann man nicht einmal die Frage erörtern, warum eine Kritik eines Darwinismuskritikers die bestehenden offenen Probleme der Evolutionstheorie nicht löst? Aber dazu müsste man anerkennen, dass die Evolutionstheorie offene Probleme hat. Damit meine ich nicht Detailprobleme innerhalb der Theorie, wie die Aufklärung des einen oder anderen Stammbaumes. Solche Probleme können gelöst werden, ohne die Grundlagen der aktuellen Theorie in Frage zu stellen.
Bauer greift aber eben diese Grundlagen an und eben das ist wohl der Grund für die heftige Reaktion. Die empirischen Daten, die er mitteilt und die von den verschiedensten Wissenschaftlern ermittelt wurden, sind wohl unbestritten. Bauer begeht aber das Sakrileg zu versuchen, diese Daten in ein anderes theoretisches System der Evolutionstheorie einzuordnen, weil er meint, dass das theoretische System der Mainstreambiologie ungeeignet zur Erklärung der Evolution ist.
Nun scheint es offensichtlich zu sein, dass die Entwicklung der Evolutionstheorie an einem Punkt angelangt ist, an dem die Frage nach der Weiterentwicklung der grundlegenden Theoreme der Theorie selbst ernsthaft diskutiert werden muss. Solche Phasen treten in der Entwicklung jeder weitreichenden wissenschaftlichen Theorie auf. Sie wurden von Wissenschaftstheoretikern wie Kuhn, Feyerabend oder Suchotin beschrieben. Das Theoriebewusstsein führender Evolutionstheoretiker scheint diesen Umstand jedoch noch nicht zu reflektieren. Die traditionelle Biologie versucht immer noch, auch „widerspenstige“ neue Daten in das traditionelle theoretische System der synthetischen Theorie einzuordnen /5/ oder möglichst nicht zur Kenntnis /6, 7/ zu nehmen. Nur in diesem Zusammenhang verstehe die teilweise wütende Reaktion auf Bauers Buch und gewisse Gegenreaktionen. Da nimmt sich Bauers Antwort vergleichsweise moderat aus.
Die Evolutionstheorie basiert auf zwei essentiellen Inputs: Mutation und Veränderung der Umwelt. Nur wenn beide Bedingungen gegeben sind, können sich durch Auslese Populationen und Arten verändern. Verändert sich die Umwelt nicht, führt auch keine Mutation zur Evolution, die Auslese wirkt stabilisierend, wie viele Mutationen auch stattfinden.
Diese beiden essentiellen Inputs werden in der Evolutionstheorie nun als zufällig angesehen, d.h. es können keine Ursachen angegeben werden, aus denen erklärt werden kann, welche Mutation oder welche Umweltveränderungen stattfinden wird. Nicht dass man für Mutation oder Umweltänderung keine Ursachen kennen würde, nur wirken diese in Bezug auf die zu erklärenden Evolution zufällig. Sie sind der zu erklärenden Evolution äußerlich und erklären sie so letztlich nicht. Die Evolutionstheorie ist also noch immer eine Theorie, die ihren Gegenstand zwar gut beschreibt, ihn aber nicht erklärt.
Mit diesem Zustand einer ihrer grundlegenden Theorien wollen sich immer mehr Biologen nicht abfinden. Sie suchen nach Möglichkeiten, Mutation und Umweltänderung aus dem Leben und seiner Evolution selbst zu erklären. Bei der Umweltänderung liegen inzwischen hinreichend viele Daten vor, die belegen, dass auch entscheidende Veränderungen der Umwelt von den Lebewesen selbst verursacht werden und so erklärbar sind. So ist die Erkenntnis, dass der Luftsauerstoff und der Erdboden Resultate der Tätigkeit der Lebewesen sind, inzwischen Lehrbuchwissen. In der Theorie der Evolution werden sie jedoch als Sonderfälle abgehandelt, während die fĂĽr die Evolution zufälligen geologischen Prozesse als die notwendigen Ursachen angesehen werden. Hier kann nur ein Paradigmenwechsel helfen, in dem die geologischen Prozesse nicht als notwendige, sondern als zufällige und die Evolution letztlich störende Ereignisse verstanden werden. Nur eine solche Theorie kann erklären, wie die Evolution als notwendige Form des Lebens selbst stattfinden kann und welche Umwege sie infolge zufälliger geologischer und kosmischer Ereignisse genommen hat. Interessante Gedanken zu diesem Aspekt findet man beispielsweise bei Morris „Life’s Solution“ /5/ oder in Gutmanns „Die Evolution hydraulischer Strukturen“ /6/
Entsprechendes gilt auch für den Faktor Mutation. Mutationen sollten nicht mehr als zufällige Fehler, sondern als notwendige Folgen des Lebens selbst dargestellt werden. Damit wird nicht gesagt, dass äußere Einwirkungen wie Strahlung oder Wärme keine Mutation auslösen können, sie sind aber keine wirklich erklärenden Faktoren, sondern stören das Verständnis der Mutation als Eigenschaft des Lebendigen nur. In die Bemühungen um ein solches Verständnis ordne ich Bauers „kooperatives Gen“ /1/ ein, aber auch beispielsweise „Die Lösung von Darwins Dilemma“ von Kirschner und Gerhart /7/.
Bei jedem Versuch, ein verbreitetes Paradigma, zu verlassen, steht man nun vor der Frage „Wie sag ich´s?“. Die Terminologie des aktuellen Paradigmas ist meist nicht geeignet, sondern deren Benutzung führt in der Regel dazu, dass das Neue nicht mehr darstellbar ist, weil der Leser es in seiner traditionellen Lesart rezipiert. Neue Termini werden nicht nur oft missverstanden, sondern bleiben oft auch unverstanden und sind den verschiedensten, manchmal auch bösartigen Unterstellungen ausgesetzt, zumal der Autor auch selbst noch oft mit dem Worte ringt.
Die Frage, wer denn nun die Evolution nicht versteht, Bauer oder Meyer, scheint mir noch offen. Das Problem, um das es – jedenfalls mir - wirklich geht, ist einer gründlicheren Diskussion wert.
15.2.2009: Nachtrag
Im Blog “Studium generale” gibt es eine umfangreiche Berichterstattung zu Simon Conway Morris.
/1/ Bauer, Joachim (2008): Das kooperative Gen * Abschied vom Darwinismus, Hoffmann u.Campe, Hamburg
/2/ Kuhn, Thomas S. (1973): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
/3/ Feyerabend, Paul (1986): Wider den Methodenzwang, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, ZĂĽrich
/4/ Suchotin, Anatoli Konstantinowitsch (1980): Kuriositäten in der Wissenschaft, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Zürich
/5/ Morris, Simon Conway (2003): Life’s Solution / Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge University Press, New York und Melbourne (deutsch: Morris, Simon Conway (2008): Jenseits des Zufalls * Wir Menschen im einsamen Universum, University Press, Cambridge)
/6/ Gutmann, Wolfgang Friedrich (1995): Die Evolution hydraulischer Strukturen * Organismische Wandlung statt altdarwinistischer Anpassung, University Press, Cambridge
/7/ Kirschner, Marc. W.; Gerhart, John C. (2007): Die Lösung von Darwins Dilemma